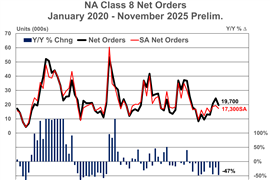Automatisch von KI übersetzt, Original lesen
Wasserstoff steht im Wettbewerb mit BEVs vor Herausforderungen
25 November 2024
Mission Hydrogen hat vor Kurzem ein Webinar zum Thema batterieelektrische Energie (BE) und deren Zukunftsaussichten veranstaltet – ein Schritt, der den Teilnehmern laut David Wenger, Gründer und CEO, für die Organisation möglicherweise ungewöhnlich erscheinen könnte.
„Danke an alle Sponsoren, die vielleicht schockiert sind, dass wir ein Webinar zum Thema Batterien veranstalten“, scherzte er in seiner Eröffnungsrede.
Der Zweck des Webinars bestand jedoch darin, „Wasserstoff-Evangelisten“ über die neuesten Entwicklungen in der Batterietechnologie zu informieren, die im Bereich Mobilität und stationärer Elektrizität oft mit Wasserstoff konkurriert.
Maximilian Fichtner, Leiter des Zentrums für Elektrochemische Energiespeicherung Ulm-Karlsruhe (CELEST), sprach zu diesem Thema. Einige seiner Ausführungen bezogen sich zwar auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor im Automobilsektor, seine Aussagen lassen sich jedoch auch auf Nutzfahrzeuge und Industrieanlagen übertragen.
Im ersten Teil seiner Präsentation konzentrierte sich Fichtner auf die Bewertung alternativer Antriebe und Antriebsstränge. Er erklärte, dass es bei mobilen Geräten und Fahrzeuganwendungen wichtig sei, einige Schlüsselfragen zu stellen, um die optimale Lösung zu finden.
„Zum Beispiel: Welchen Beitrag leisten Sie zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) und zu den Kosten der Treibhausgasreduzierung?“, fragte er. „Wie effizient ist der Antrieb? Kommt die gesammelte erneuerbare Energie wirklich mehr oder weniger direkt an die Räder oder wird der Großteil davon in nutzlose Wärme umgewandelt?“
Fichtner fügte hinzu, dass es auch wichtig sei, die Rohstoffversorgung zu prüfen, da dies dazu beitragen könne, die Machbarkeit des Baus einer Fahrzeug- oder Geräteflotte zu bestimmen. Weitere Fragen seien Kosten, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
Bewertung der Treibhausgasreduzierung
Um den Beitrag einer Energiequelle zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu bewerten, müsse man über einzelne Aspekte der Energiequelle hinausblicken, sagte Fichtner.
„Man führt eine sogenannte Lebenszyklusanalyse durch und diese umfasst alles vom Abbau der Rohstoffe über die Nutzung des Autos bis hin zur endgültigen Lagerung oder dem Recycling“, sagte er.
 Zehn Nikola Tre Brennstoffzellen-Elektro-Lkw in den Farben des kalifornischen Logistikunternehmens Biagi Bros. (Foto: Biagi Bros.)
Zehn Nikola Tre Brennstoffzellen-Elektro-Lkw in den Farben des kalifornischen Logistikunternehmens Biagi Bros. (Foto: Biagi Bros.)Eine solche Analyse berücksichtigt die Herstellung des Fahrzeugchassis, die Fahrzeugwartung sowie die Kraftstoff- bzw. Stromerzeugung. Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (IC) und Plug-in-Hybridfahrzeugen (PHEV) spielt der Kraftstoffverbrauch eine wichtige Rolle. Bei Verbrennungsmotoren, die mit Erdgas oder Biogas betrieben werden, spielt auch das 20-jährige Treibhauspotenzial (GWP) von Methan eine Rolle, ebenso wie bei Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV), die mit grauem Wasserstoff betrieben werden, der aus Erdgas oder Methan hergestellt wird.
Bei batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) müssen die Treibhausgasemissionen aus der Batterieherstellung berücksichtigt werden. Bei FCEVs umfasst die Analyse auch die Herstellung des Wasserstofftanks.
Bei der Bewertung der Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus aller dieser Fahrzeugtypen anhand von Daten des International Council on Clean Transportation (ICCT) sagte Fichtner, dass die Elektrovarianten, einschließlich PHEVs, im Vergleich zu ihren Gegenstücken mit Verbrennungsmotor geringere Emissionen aufweisen.
Gemessen in Gramm CO2-Äquivalent pro Kilometer (g CO2 eq/km) lagen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bei etwa 250. PHEVs kamen auf etwa 200.
BEVs und FCEVs wurden in zwei Gruppen unterteilt: Fahrzeuge, die mit heutigen Energie- oder Kraftstoffquellen betrieben werden, und zukünftige Fahrzeuge, die vollständig erneuerbare Energiequellen nutzen. Heutige BEVs sind beispielsweise auf Netzstrom angewiesen, der teilweise aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Ihr CO2-Ausstoß liegt bei etwa 90 g/km. BEVs, die potenziell vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben werden, kommen auf etwa 50 g/km CO2-Ausstoß.
Herausforderungen bei E-Fuels
Insbesondere im Hinblick auf Verbrennungsmotoren ging Fichtner auf die Zukunft der E-Fuels ein, „die synthetisch durch die Fischer-Tropsch-Reaktion von CO2 und Wasserstoff hergestellt werden.“
Fichtner wies jedoch auf mehrere Probleme im Zusammenhang mit der Zukunft von E-Fuels hin, die diese seiner Meinung nach als Ersatz für fossile Brennstoffe unhaltbar machen. Zunächst einmal sind enorme Mengen CO2 erforderlich, um ausreichende Mengen an E-Fuel für den Einsatz auf der Straße zu produzieren.
„Ich persönlich glaube, dass das größte Problem darin besteht, das CO2 wirklich einzufangen“, sagte er.
Darüber hinaus besteht ein weiteres Problem darin, genügend Anlagen zur Herstellung von E-Fuels bereitzustellen.
Die Internationale Energieagentur (IEA) hat weltweit alle Projekte zur Herstellung von E-Fuels erfasst und kommt auf eine globale Produktionsmenge von 45 Terawattstunden (TWh) pro Jahr. Das klingt nach einer riesigen Zahl – und es ist eine riesige Zahl. Tatsächlich entspricht sie aber etwa einem Tausendstel der weltweiten Ölproduktion.
Was die Zukunft der E-Fuels noch schlimmer mache, so Fichtner, sei die Tatsache, dass laut IEA nur ein bis zwei Prozent der E-Fuel-Projekte durch Investitionen abgesichert seien – oder ein Hunderttausendstel der heutigen Ölproduktion.
„Diese Entscheidungen hätten getroffen werden müssen, wenn man bis 2035 wirklich mit riesigen Mengen an E-Fuels auskommen will“, sagte Fichtner.
Dennoch bleibt Fichtner ein Befürworter von E-Fuels, allerdings nur für bestimmte Anwendungen.
„Wir brauchen sie viel dringender für Schiffe, für Boote und für Flugzeuge“, sagte er.
FCEVs werden heute häufig mit grauem Wasserstoff betrieben. Ihr CO2-Ausstoß liegt bei etwas über 200 g/km. FCEVs, die künftig mit grünem Wasserstoff betrieben werden könnten, erreichen dagegen einen CO2-Ausstoß von 60 bis 70 g/km.
Fichtner fügte hinzu, dass es eine Debatte darüber gebe, ob es für grünen Wasserstoff ein Geschäftsmodell gebe.
In der Realität gibt es keinen grünen Wasserstoff. Insgesamt besteht unser Gemisch zu über 99 Prozent aus fossilen Quellen, also Methan. Die Tankstellen in Deutschland werden hauptsächlich von einer großen Anlage in Leuna beliefert, die grauen Wasserstoff produziert. Das bedeutet, dass Brennstoffzellenautos derzeit kaum zur Verbesserung der Klimasituation beitragen. Mit grünem Wasserstoff ließe sich zwar einiges verbessern, aber das müssen wir erst einmal erreichen.
Vergleich der EV-Effizienz
Bei der Betrachtung der Fahrzeugeffizienz entlang der Lieferkette und dem Vergleich von BEVs mit FCEVs sind BEVs laut Fichtner mit einem Wirkungsgrad von rund 75 Prozent die klaren Gewinner. Dies liegt daran, dass die Lieferkette bei BEVs recht kurz ist und nur eine Stromquelle und die Übertragung zum BEV umfasst, wo der Strom gespeichert wird.
Im Vergleich dazu mindern alle Schritte der Lieferkette, die erforderlich sind, um Wasserstoff in ein FCEV zu bringen, die Gesamteffizienz des Fahrzeugs. Dazu gehören laut Fichtner die Stromgewinnung, die Elektrolyse, die Reinigung und Lagerung des Brennstoffs, die Druckbeaufschlagung und der Transport, die Lagerung an einer Tankstelle, die Kühlung und Druckbeaufschlagung, die Betankung des Fahrzeugs und die damit verbundenen Effizienzverluste der Brennstoffzelle selbst.
„Insgesamt komme ich auf 18 bis 20 Prozent [Effizienz]“, sagte Fichtner über FCEVs. „Studien stoßen oft auf Werte von 30 oder 33 Prozent. Schaut man sich die Annahmen in den Studien genauer an, wird deutlich, dass sie typischerweise von einem drucklosen Szenario ausgehen, in dem es keine Druckverluste gibt. Und die Verluste an der Tankstelle werden aus irgendeinem Grund immer vernachlässigt, weil es vielleicht keine öffentlich verfügbaren Zahlen gibt.“
Herausforderungen beim H2-Trucking
Fichtner ging auch auf die Unterschiede zwischen der Einsatzfähigkeit von BEVs und FCEVs im Lkw-Verkehr ein. Er konzentrierte sich dabei auf die Bedürfnisse der Transportbranche.
„Was in ihrem Geschäft wirklich zählt, ist, dass die Kosten ein großes Thema sind“, sagte er, „insbesondere die Kosten pro Kilometer.“
In Anbetracht dessen sagte Fichtner, dass der Preis für grünen Wasserstoff laut der Beratungsfirma P3 Automotive erst unter 4 bis 5 Euro (4,19 bis 5,24 US-Dollar) pro Kilogramm wettbewerbsfähig sein werde.
„Derzeit zahlen wir in Deutschland 16 bis 17,75 Euro pro Kilogramm“, sagte er. „Es handelt sich um grauen Wasserstoff, und er wird subventioniert – es gibt keine Steuer darauf.“
 Die Langstreckenversion des FH Electric von Volvo Trucks kommt in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt. (Foto: Volvo Trucks)
Die Langstreckenversion des FH Electric von Volvo Trucks kommt in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt. (Foto: Volvo Trucks)Fichtner wiederholte seine früheren Äußerungen zur Zukunftsfähigkeit von grünem Wasserstoff und äußerte Bedenken hinsichtlich des Erreichens des Zielpreises. Um den Zielpreis zu erreichen, müssten die Elektrolyseurkosten um etwa 80 Prozent gesenkt, die Stromkosten für die Brennstoffproduktion um etwa 25 Prozent reduziert und die Effizienz der Elektrolyseure um etwa 6 Prozent verbessert werden, sagte er. Er wies zudem darauf hin, dass die Konkurrenz durch Elektrofahrzeuge mit sinkenden Batteriekosten zunehmen werde.
Zum Thema Wasserstoff sagte Fichtner: „Der große Vorteil, von dem ich immer höre, dass man die Tanks schnell wieder auffüllen kann, spielt keine Rolle. Die Leute, die solche Lkw tatsächlich fahren, sagen: Okay, nach 4,5 Stunden muss unser Fahrer eine Stunde Pause machen. In dieser Stunde parke ich meinen Elektro-Lkw vor einem 350-kW-CCS-Ladegerät. In dieser Stunde lade ich genug, um den nächsten Ladeplatz zu nutzen. Es spielt also keine Rolle, ob Ihr Lkw in 15 oder 50 Minuten lädt.“
Fichtner stellte auch Unterschiede bei den Kraftstoffkosten fest, bei denen BEVs gegenüber Wasserstofffahrzeugen die Nase vorn zu haben scheinen.
Fichtner sagte, ausgehend von Dieselkraftstoff werde ein 40-Tonnen-Lkw etwa 0,45 Euro/km (0,79 Dollar/Meile) verbrauchen. Unter Berufung auf Daten von Nikola sagte er außerdem, ein in Deutschland betriebenes FCEV werde etwa 1,40 Euro/km (2,45 Dollar/Meile) grauen Wasserstoff verbrauchen.
„Im Vergleich dazu verbraucht ein 40-Tonnen-Elektro-Lkw laut einem aktuellen Test des Daimler eActros 90 kWh pro 100 km“, sagte Fichtner. „Je nach Tarif macht das etwa 0,35 bis 0,55 Euro/km (0,61 bis 0,96 US-Dollar/Meile).“
Aus diesem Grund sieht man laut Fichtner immer mehr elektrifizierte Lkw auf den Straßen.
„Es gibt auch mehr Brennstoffzellen-Lkw, aber das Verhältnis zwischen beiden liegt bei etwa 80 zu eins“, sagte er. „Es gibt 80-mal mehr BEV-Lkw und Neuzulassungen als FCEV-Lkw.“
POWER SOURCING GUIDE
The trusted reference and buyer’s guide for 83 years
The original “desktop search engine,” guiding nearly 10,000 users in more than 90 countries it is the primary reference for specifications and details on all the components that go into engine systems.
Visit Now
STAY CONNECTED




Receive the information you need when you need it through our world-leading magazines, newsletters and daily briefings.
KONTAKT ZUM TEAM